Beim ersten Kind war alles neu – und ehrlich gesagt: ein bisschen überfordernd. Ich habe mir Sorgen gemacht, wenn mein Baby nicht die Mengen gegessen hat, die im Rezept oder Plan standen. Ist das normal? Wird es satt? Mache ich etwas falsch?
Beim zweiten Kind sieht das ganz anders aus. Ich bin entspannter, gelassener – und vielleicht auch etwas pragmatischer. Ich weiß jetzt: Beikost ist ein Prozess, kein Rennen. In diesem Blogpost teile ich 11 Dinge, die ich dieses Mal ganz bewusst anders mache – vielleicht ist ja auch etwas dabei, das dir den Beikoststart leichter macht.
Denn was ich in den letzten Jahren gelernt habe: Es geht nicht nur ums Was auf dem Teller, sondern vor allem ums Wie. Wie wir an das Thema Beikost herangehen, prägt oft viel mehr als die perfekte Rezeptauswahl. Und genau da beginnt auch mein erster Punkt: mit meiner eigenen Haltung.
1. Meine Haltung: Mein Kind darf essen – es muss nicht
Beim ersten Kind wollte ich alles „richtig“ machen – und das bedeutete für mich damals auch, dass mein Baby möglichst zügig möglichst „gut“ essen sollte. Heute denke ich ganz anders. Was ist denn überhaupt „gut essen“.
Ich folge der sogenannten Verantwortungsteilung nach Ellyn Satter: Ich bestimme, was auf den Tisch kommt – mein Kind entscheidet, ob und wie viel es davon isst. Diese Haltung gilt nicht erst am Familientisch, sondern schon ab dem allerersten Löffel Brei oder Stückchen Gemüse.
Das nimmt enorm viel Druck raus – für beide Seiten. Und: Kinder entwickeln so ein gesundes Gefühl für Hunger und Sättigung.
📚 Quelle: Ellyn Satter Institute – Division of Responsibility in Feeding
2. Ich bewerte das Essverhalten meines Kindes nicht mehr
Was mir erst beim zweiten Kind wirklich bewusst wurde: Wie oft wir das Essverhalten unserer Kinder – meist ganz unbewusst – bewerten.
Sätze wie: „Du hast aber gut gegessen!“ oder „Heute war’s aber wenig.“ habe ich beim ersten Kind oft gesagt. Es war nie böse gemeint, sondern einfach meine spontane Beobachtung. Aber: Was heißt denn eigentlich „gut essen“?
Woher will ich wissen, was mein Baby gerade braucht – in seinem jeweiligen Entwicklungsschritt, in seinem eigenen Tempo? Genau – das kann ich nicht wissen. Und deshalb bin ich dazu übergegangen, nicht mehr zu bewerten.
Das war anfangs gar nicht so leicht, denn solche Kommentare rutschen schnell raus.
Ich begleite mein Kind neutral, lasse es selbst spüren, wann es satt ist oder was es mag. Essen darf bei uns einfach da sein – ohne Druck, ohne Erwartungen, ohne Bewertung. Und das fühlt sich richtig gut an.
3. Kein Beikostplan auf der Küchentheke
Bei Kind 1 hatte ich den Beikostplan vom Forschungsinstitut für Kinderernährung (FKE) ausgedruckt und am Kühlschrank hängen. Ich habe mich gestresst, wenn mein Baby „nicht schnell genug“ eine ganze Milchmahlzeit ersetzt hat.
Dieses Mal bin ich intuitiver: Bereits nach zwei Wochen habe ich mein Baby zu unseren vier Familienmahlzeiten dazugesetzt. Er durfte zuschauen, mitfühlen, mitschmecken – auch wenn er noch kaum etwas gegessen hat. Dadurch hat er nicht nur mehr Lebensmittel kennengelernt, sondern auch das ganze Drumherum beim Essen: Gespräche, Stimmung, Rituale.
📚 Quelle: FKE Beikostplan
4. Ich habe früher begonnen – mit gutem Grund
Die WHO empfiehlt 6 Monate ausschließliches Stillen – das habe ich beim ersten Kind so gemacht. Bei meinem zweiten Baby waren die Beikostreifezeichen um den 5. Monat erfüllt und deshalb habe ich auch früher mit der Beikost begonnen.
Ich habe mich dabei an die Empfehlungen der ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) gehalten: Sie empfehlen ab dem 5. Monat mit Beikost zu beginnen – wenn das Kind reif dafür ist. Denn es gibt ein sogenanntes „Window of Opportunity„, in dem Babys besonders gut neue Geschmäcker und Texturen kennenlernen und akzeptieren.
📚 Quelle: ESPGHAN Beikost-Empfehlungen 2017
5. Ich achte auch auf meine Reifezeichen
Ja, mein Baby war bereit. Aber war ich es auch? Beim ersten Kind hatte ich schon etwas Angst vor dem Verschlucken, habe Würgen oft fehlinterpretiert und ständig daneben gesessen mit klopfendem Herzen.
Dieses Mal habe ich mich besser vorbereitet: Ich habe mir Videos angeschaut, wie sich Würgen von einem echten Notfall unterscheidet. Das hat mein Selbstvertrauen enorm gestärkt. Und das hilft nicht nur mir, sondern überträgt sich auch auf mein Kind.
6. Mehr Abwechslung, wiederholtes Anbieten
Früher war ich unsicher und bin tagelang bei Karotte, Kürbis und Pastinake geblieben. Jetzt gibt es jeden Tag etwas anderes: Brokkoli, Kichererbsen, Pfirsich, Hummus, Hirse, Linsen, Kohl, Haferflocken… Und wenn mein Baby etwas nicht mag, dann bewerte ich das nicht, sondern biete das Lebensmittel in ein paar Tagen einfach nochmal an.
Ich achte darauf, dass mein Baby jeden Tag neue Farben, Texturen und Geschmäcker erlebt. Das fördert nicht nur die sensorische Entwicklung, sondern macht das Essen auch spannender – für alle!
Quelle: Maier-Nöth (2023): The Development of Healthy Eating and Food Pleasure in Infancy, Maier-Nöth (2007): Effects of repeated exposure on acceptance of initially disliked vegetables in 7-month old infants
7. Allergene früh und regelmäßig anbieten
Beim ersten Kind war ich beim Thema Allergene noch sehr vorsichtig. Ich dachte, man soll immer nur ein neues Lebensmittel einführen, dann ein paar Tage abwarten, bevor das nächste kommt – besonders bei potenziellen Allergenen wie Ei, Nüsse oder Milchprodukte. Heute weiß ich: Diese Empfehlung ist überholt.
Aktuelle Studien und Fachgesellschaften wie die ESPGHAN empfehlen, Allergene frühzeitig und regelmäßig anzubieten – natürlich nur, wenn das Kind gesund ist und keine bekannten Allergierisiken bestehen.
Der frühe Kontakt mit allergenen Lebensmitteln kann sogar das Risiko für spätere Allergien senken. Entscheidend ist: nicht isoliert, sondern im Rahmen einer normalen, vielfältigen Beikost.
Also gab’s bei uns dieses Mal ganz selbstverständlich Ei zum Frühstück, mal etwas Mandelmus im Brei oder ein Löffel Joghurt zum Löffeln. Nicht alles auf einmal – aber auch nicht mehr einzeln mit langen Pausen dazwischen.
Mein Fazit: Allergene dürfen dazugehören – genauso wie anderes Essen auch. Wenn du unsicher bist oder familiäre Allergien vorliegen, sprich mit eurer Kinderärztin oder einem Allergologen. Aber in den allermeisten Fällen gilt: Je entspannter und natürlicher – desto besser.
📚 Quelle: S3-Leitlinie Allergieprävention (2022), ESPGHAN Beikost-Empfehlungen (2017), LEAP-Studie (2015)
7. Keine typischen Babygerichte – lieber echte Familienkost
Milchreis, Grießbrei, Babyzwieback – das isst bei uns niemand. Warum also für das Baby extra kochen?
Stattdessen gibt’s angepasste Familienkost: Gemüsesuppe (ungesalzen), Linsenbolo, Gewürzreis oder Naturjoghurt. So wird das Baby vom ersten Tag an Teil unserer Esskultur – und ich muss nicht doppelt kochen. Das macht den Alltag einfacher und nachhaltiger.
8. Ich war kein einziges Mal in der Baby-Abteilung
Baby-Porridge? Spezielle Quetschies? Überteuerte Gläschen? Habe ich diesmal alles weggelassen. Statt Baby-Porridge beispielsweise habe ich von Anfang an Haferflocken verwendet, die wir als Familie ohnehin essen – zuerst zart, dann aber ziemlich zügig grob.
Fertige Produkte sind oft stark verarbeitet, enthalten Zusatzstoffe oder Zucker und kosten das Drei- bis Vierfache. Ich vertraue lieber auf einfache, vollwertige Zutaten – frisch und ohne viel Verpackung.
9. Kein raffiniertes Rapsöl – lieber gute Öle wie für uns alle
In vielen Beikostratgebern steht: „Ein Teelöffel Rapsöl dazu.“ Das habe ich beim ersten Kind gemacht – bis ich gelesen habe, dass raffinierte Öle Schadstoffe wie 3-MCPD-Fettsäureester enthalten können. Diese stehen im Verdacht, in Tierversuchen zu Nierenschäden und gutartigen Tumoren zu führen.
Ich habe mich deshalb für Olivenöl und Leinöl entschieden – genau die Öle, die wir als Familie ohnehin essen. Manche sagen, das sei „zu bitter für Babys“. Aber ich finde: Babys können alles lernen – auch Geschmack. Und vielleicht war das Öl sogar eine Brücke, um neue Gemüse zu akzeptieren.
📚 Quelle: BfR-Bericht zu 3-MCPD in raffinierten Ölen
10. Mehr Fokus auf Eisen
Beim ersten Kind hieß es vom Kinderarzt: „Am besten jeden Tag Fleisch.“ Das fand ich übertrieben – und habe es ehrlich gesagt nicht umgesetzt.
Bei Kind 2 wurde nach sechs Monaten zufällig festgestellt, dass der Eisenwert erniedrigt war. Deshalb habe ich gezielt darauf geachtet, zu jeder Mahlzeit etwas Eisenreiches anzubieten: Leber, rotes Fleisch, Hummus, Tahini, Kichererbsen, Linsen, Tofu, Cashew- und Kürbiskernmus. Nach vier Wochen war der Wert optimal.
Eisen ist ein kritischer Nährstoff in der Beikost, weil der Eisenspeicher aus der Schwangerschaft etwa ab Monat 6 aufgebraucht ist – und Muttermilch liefert nur geringe Mengen. Am besten schon in der Schwangerschaft eisenreiche, pflanzliche Lebensmittel in die Ernährung einbauen – da kann man Eisen auch meist ganz gut gebrauchen, dann bist du für die Beikost bestens gerüstet.
📚 Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
Fazit: Beikost darf entspannt sein – und Spaß machen
Was ich aus der Beikost mit meinem zweiten Kind mitgenommen habe: Es gibt nicht den einen richtigen Weg.
Es gibt deinen Weg. Und der darf sich verändern – mit jedem Kind, mit deiner Erfahrung, mit eurem Familienalltag.
Vieles, was mir beim ersten Mal wichtig erschien, war rückblickend gar nicht so entscheidend. Dafür habe ich andere Dinge neu entdeckt, losgelassen, ausprobiert. Das Wichtigste war für mich: Vertrauen – in mein Kind, in mich, in unser gemeinsames Tempo.
Wenn du gerade mitten in der Beikost steckst oder bald damit startest, dann wünsche ich dir: Neugier, Gelassenheit und Freude am gemeinsamen Essen. Und die Sicherheit, dass du keine perfekte Lösung brauchst – sondern nur eine, die zu euch passt. Brauchst du dabei Unterstützung? Wir begleiten dich und deine Familie, während du dein Kind begleitest.
Was habt ihr ab dem zweiten Kind in der Beikost anders gemacht?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren oder in der croomel Community!
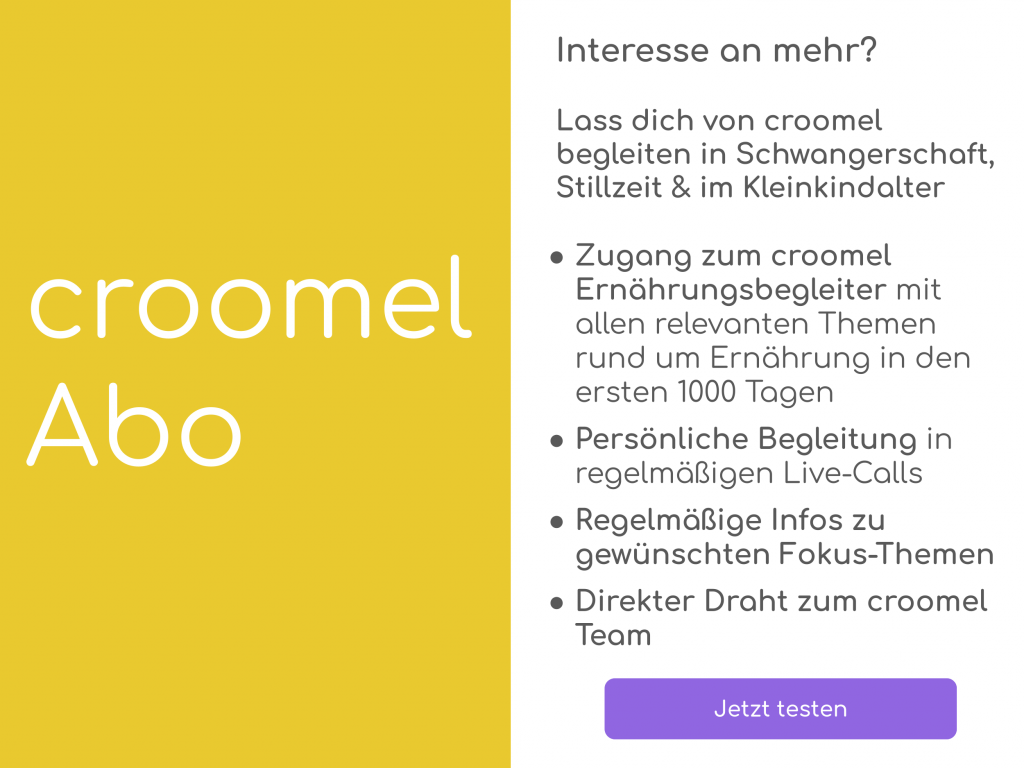




3 Comments
Christine Schafberg
Hallo Andrea, ich habe den Bericht gelesen und er gefällt mir sehr gut. Was ich allerdings vermisse, ist die Empfehlung für ein gutes Omega 3 Öl. Wir beide wissen doch, dass Leinöl nicht ausreichend umgewandelt werden kann in die soooo wichtigen Fettsäuren EPA und DHA. L. G. Christine
Christina von croomel
Hallo Christine! Vielen Dank für dein Feedback. Das freut uns, dass der Blogpost dir gefallen hat. Du hast vollkommen recht, dass Omega-3-Fettsäuren wichtig sind. Dieser Blogpost ist ein sehr persönlicher Bericht, was ich bei meinem zweiten Kind in der Beikost anders mache. Omega-3-Öl habe ich schon bei meinem 1. Kind während der Stillzeit supplementiert und das beim 2. Kind beibehalten; deshalb kommt es hier nicht vor. Wir planen einen Blogpost nur zum Thema Omega-3-Fettsäuren ein. Liebe Grüße, Christina